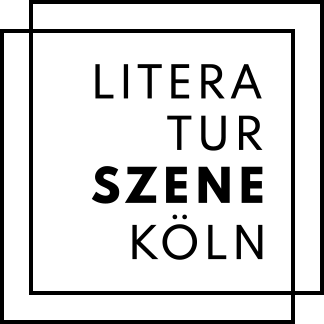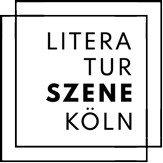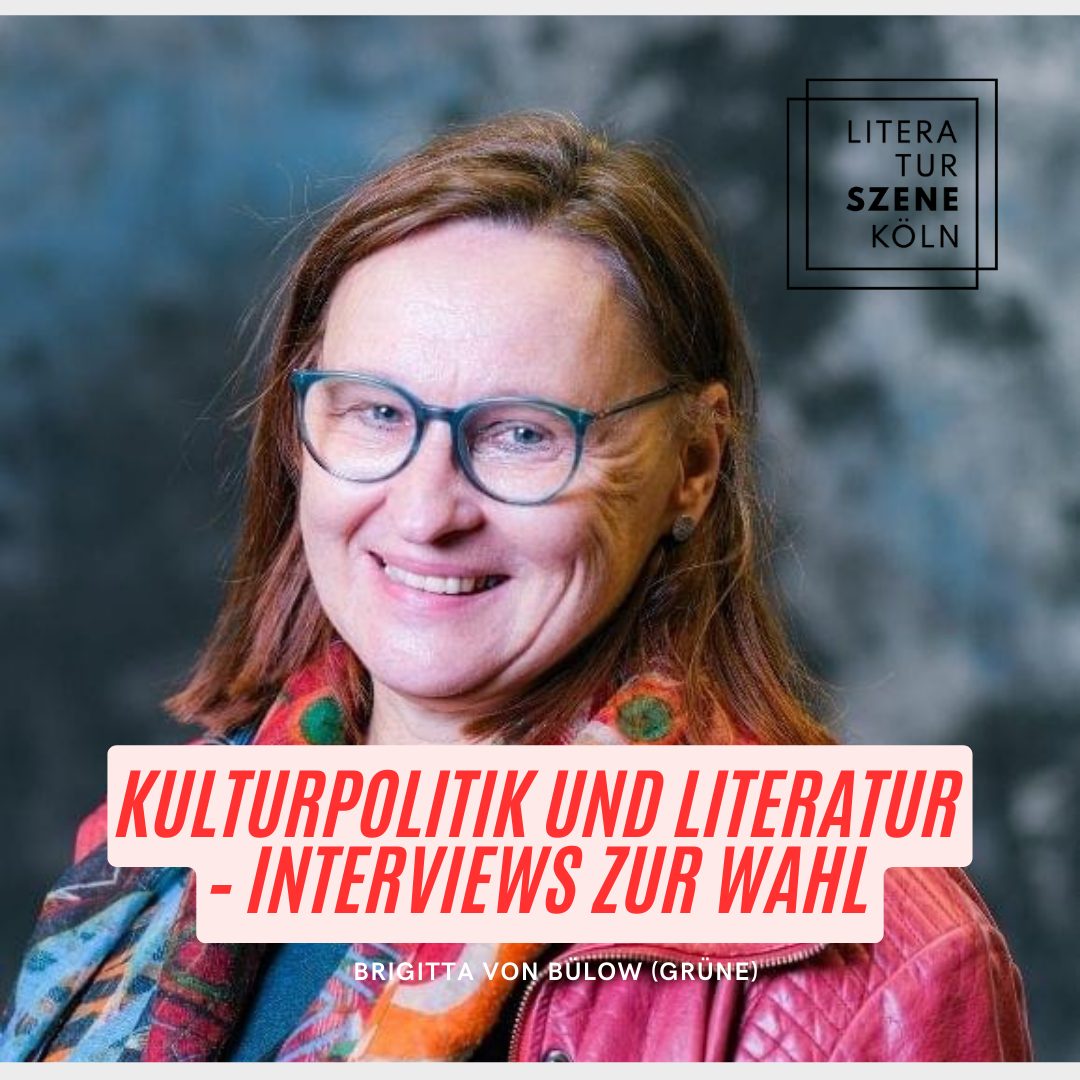Vom 6. bis 8. Juni findet in Köln das Symposium „Schreiben, was kommt“ statt. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher, an wen richtet sich das Programm?
Ulrike Draesner: An jede:n, die sich für zeitgenössisches Schreiben, für zeitgenössische Kunst interessiert. Wenn wir genau wüssten, was geboten wird, würden wir es übrigens nicht veranstalten. Das Ganze ist ein großes Experiment: Wir machen uns gemeinsam auf den Weg herauszufinden, was uns umtreibt, was schwer in Worte zu fassen ist, was wir suchen und versuchen. Wir haben über 60 Menschen mit Energie und Aufbruchskraft, Träumen und Zweifeln eingeladen. Zum Sprechen. Und Zuhören.
Kathrin Röggla: Im Programm findet sich eine große Vielfalt der Themen, die nicht nur in der literarischen Öffentlichkeit heftig diskutiert werden: KI, Politisierung der Diskurse, Umgang mit ökologischen Herausforderungen, mit Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft, und was sich unter ästhetischer Forschung verbirgt, ist nichts weniger als die Fragen, die sich um Möglichkeiten der Wissenserzeugung und Welterkundung beziehen. Neue kollektive Formen der Kunstproduktion stehen neben – da das Ganze keine reine Theoriesache ist, sondern eine sinnlich-konkrete Form der Auseinandersetzung, erzeugt diese Vielfalt an Formen. Es wird eine zentrale Begegnung der Szene.
Es ist die erste gemeinsame Veranstaltung der deutschsprachigen Schreibinstitute Köln, Leipzig, Wien und Hildesheim. Warum zum jetzigen Zeitpunkt und wie ist es dazu gekommen?
Ulrike Draesner: In den Instituten hat in den letzten Jahren ein Generationenwechsel stattgefunden, was die Lehrenden angeht. Wir setzen auf Diversität und Vernetzung, auf Austausch, fluide Poetiken und Mehrsprachigkeit. Früher wurden gern Anthologien herausgegeben, wenn es darum ging, über die Praktiken des literarischen Schreibens nachzudenken. Auch dieses Format haben wir verändert. Wir tun es zusammen mit Studierenden, mit der Öffentlichkeit – dialogisch und mehrstimmig. Die Grenzen zwischen dem „Primären“ und „Sekundären“ verschieben sich, ebenso wie die möglichen Funktionen oder Aufgaben von Kunst. U.a. davon wird man in Köln hören.
Kathrin Röggla: Schreibschulen boomen. Das ist ja ein relativ neues Phänomen, zumindest in dieser Breite im deutschsprachigen Raum. Wo das hinführt – keine Ahnung! Jedenfalls zeigt es sich, dass durch die studentische Vernetzung der Hochschulen ein diskursiver Raum entstanden ist, der immer wieder die Fragen in den raum stellt, die nicht nur für den Literaturbetrieb insgesamt interessant wirken. Wir antworten auf dieses Phänomen und wollten eine konkrete Verständigung und Auseinandersetzung herstellen. Da die Beteiligten sich zu einem großen Teil kennen und in Kontakt stehen, schien das uns nur folgerichtig, einmal die große Öffentlichkeit zu suchen in all der von Ulrike Draesner beschriebenen Vielfalt.
An insgesamt drei Tagen wird in Köln mit über 60 Gästen aus der literarischen Praxis und Theorie diskutiert: Wie sind Sie an die Programmarbeit herangegangen, was war Ihnen bei der inhaltlichen Gestaltung besonders wichtig?
Ulrike Draesner: Jedes Institut hat Schwerpunkte gesetzt, die aus der eigenen Arbeit erwachsen. Wir haben unterschiedliche Profile – und so kam sehr schnell ein breites Themenspektrum zusammen. Es geht uns darum, auch voneinander zu lernen, und uns gegenseitig an unserer Expertise, gerade auch was Lehrformen und Bedürfnisse der jungen Literat:innen angeht, teilhaben zu lassen.
Kathrin Röggla: Wir sind sehr glücklich über dieses Themenspektrum. Dahinter stand natürlich eine immer wiederkehrende Diskussion und Abstimmung, viele Gespräche und Wünsche, die sich entlang eines ein-zweijährigen Planungsprozesses entwickelt haben.
Frau Röggla, Sie unterrichten Literarisches Schreiben an der KHM in Köln, Sie liebe Frau Draesner, sind Professorin für literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut. Was sind die drängenden Fragen der Studierenden aktuell? Gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Konsens, der sich in ihrer literarischen Arbeit niederschlägt?
Ulrike Draesner: Einen Konsens sehe ich nicht, wohl aber Fragen, die unsere Gesellschaft angehen und sich in den Texten und Lebensthemen der Studierenden spiegeln. Die Kriege, die Umweltzerstörung, Diversität, soziale Gerechtigkeit – um nur ein paar zu nennen. In Leipzig kommt dem Ost-West-Thema, das seit einem guten Jahr gesamtgesellschaftlich mit erneuter Rigorosität angegangen wird, Bedeutung zu. Mitsamt der politischen Spannungen, die damit verbundne sind. Diese Diskurse betreffen die Genese und die Bewertung von Literatur.
Kathrin Röggla: Das ist ja das spannende, das jedes Institut seine eigene Handschrift hat. Hier in Köln an der KHM ist das der transdisziplinäre und sehr internationale Zugang zum Schreiben. Das offene Studium der medialen Künste als Projektstudium bringt erstmal ganz andere Fragen als ein universitär eingebundenes Studium. Aber am Ende kommen doch viele Fragen wieder zusammen, gerade in dem von Ulrike Draesner benannten Rahmen. Kriege und eine Gesellschaft, geprägt durch social media und social bubbles, die Spaltungen hervorruft, die ökologischen Multikrisen sind unser gemeinsamer Rahmen. Man erwartet ja von der Literatur immer auch etwas Weltauslegung und kritische Praxis, und hier wird es im Moment äußerst herausfordernd. Zudem geht es immer auch um Teilhabe am Diskurs.
Das Programm liest sich eindrucksvoll: Neben Ihnen beiden sind u.a. Autorinnen und Autoren wie Olga Grjasnowa, Annette Pehnt, Ulrich Peltzer, Annika Reich oder Monika Rinck zu Gast. Haben Sie besondere Programm-Empfehlungen?
Ulrike Draesner: Ich empfehle: Thermosflasche und Gesamtticket.
Kathrin Röggla: Und ich schließe mich dieser Empfehlung vollumfänglich an.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ulrike Draesner (*1962) hat sieben Romane, zuletzt „Die Verwandelten“, sieben Gedichtbände, zuletzt hell & hörig, mehrere Erzählungs- und Essaybände veröffentlicht. Nach Jahren in England lebt sie heute in Berlin und Leipzig, wo sie Professorin für literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut ist. Für ihr literarisches Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Gertrud-Kolmar-Preis (2019), den Preis der Literatour Nord (2020), den Deutschen Preis für Nature Writing 2020, den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds 2021, sowie den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2024.. Im Herbst 2024 erscheint ihr neuer Roman „zu lieben“. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Kathrin Röggla (*1971 Salzburg) lebt in Köln. Sie ist Schriftstellerin und arbeitet als Prosa- und Theaterautorin, auch entwickelt sie Radiostücke. Eben erschien ihr Roman „Laufendes Verfahren“ (S.Fischer, 2023) und das Theaterstück „Das Wasser“ (Reclam, 2023). Für ihre literarischen Arbeiten erhielt sie zahlreiche Preise, zuletzt den Else Lasker-Preis (2022), den Großen Kunstpreis des Landes Salzburg (2023) und den Heinrich-Böll-Preis (2023). Sie ist Rundfunkrätin des RBB und unterrichtet Literarisches Schreiben an der KHM in Köln und betreibt mit Leopold von Verschuer eine Änderungsschreiberei.
Das Symposium findet in Kooperation mit dem Literaturhaus Köln statt und wird gefördert von der Kunststiftung NRW, dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, dem Deutschen Literaturfonds, der Crespo Foundation sowie dem Kulturamt der Stadt Köln und der Universitätsstiftung Leipzig.