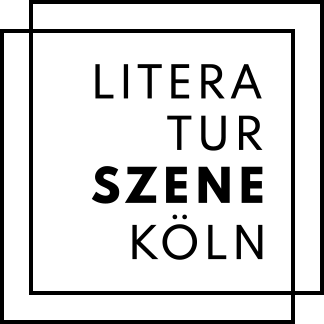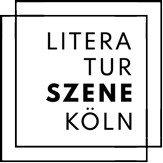Gespräche und Interviews gestalten sich zu Corona-Zeiten nicht so einfach, wie wir es gerne hätten: nämlich persönlich und in echt. Spazierengehen ist das neue Alles und Tagesabläufe scheinen nur noch aus Zoom-Meetings zu bestehen. Um mit Paul Berf, Übersetzer und Mitglied der Literaturszene Köln zu sprechen, haben wir ganz klassisch zum Telefon gegriffen. Das Festnetz erschüttert weder ein leerer Akku, noch eine instabile Internetverbindung. Paul Berf ist in diesen Tagen wie die meisten von uns: zu Hause.
von Paula Döring
Hat sich durch Corona etwas an deiner Arbeitsweise verändert? Wahrscheinlich nicht ganz so viel, oder?
Paul Berf: Nein, ich bin durch meine Arbeit als Übersetzer eh im ständigen Homeoffice. (lacht) Seit über 30 Jahren kenne ich es nicht anders. Auch an der Auftragslage hat sich zum Glück kaum etwas verändert: Bücher werden weiter eingekauft, auch von den Verlagen, und somit Lizenzen weiter vergeben. Das Einzige, was man merkt, ist, dass hier und da ein Titel geschoben wird und es zu einer Art Veröffentlichungsstau der Bücher kommt. Als Übersetzer werde ich nach Abgabe des Buches bezahlt und nicht nach Erscheinen. Was ich mir jedoch vorstellen kann, ist, dass es jüngere Kolleginnen und Kollegen momentan nicht leicht haben. Verlage gehen auf Nummer sicher, große Autorinnen und Autoren werden weiter veröffentlicht, das heißt, wir etablierten ÜbersetzerInnen werden verlässlich gebucht. Manch kleinere Verlage wollen allerdings jetzt gerade keine großen Risiken eingehen und halten NachwuchsschriftstellerInnen zurück. Das wiederum trifft dann junge ÜbersetzerInnen, die am meisten darauf angewiesen sind.
Du übersetzt vor allem aus dem Schwedischen, später ist das Norwegische hinzugekommen. Wieso hast du dich für die skandinavischen Sprachen entschieden?
Eigentlich ist Lars Gustafsson schuld. (lacht) Schon mit 14 habe ich seine Bücher gelesen und als ich mich später an der Uni ganz naiv für Germanistik und Anglistik eingeschrieben habe, wurde mir gesagt, dass ich für den Magister ein drittes Fach wählen muss. Da ist mir Gustafsson in den Sinn gekommen und ich habe mich spontan für Skandinavistik entschieden. Es war also eher Zufall – oder nein, vielleicht doch auch eine literarische Entscheidung. Meine Motivation war sicherlich der Wunsch, Autorinnen und Autoren im Original lesen zu können.
Und dann, wie ging es dann beruflich für dich weiter?
Nach dem Studium habe ich weiter an der Uni gearbeitet – jedoch während meines Studiums ein Jahr in Schweden verbracht und dort ein Praktikum bei einem kleinen und eher linken Verlag gemacht. Sie verlegten damals den noch unbekannten Henning Mankell, selbst ein Alt-68er. Der Verlag hat mir die Übersetzung der ersten beiden Krimis von Mankell vermittelt. Das war eine unglaubliche Chance: Das war wie eine Visitenkarte, plötzlich war ich offiziell Übersetzer und dann noch von einem Autor, der so bekannt werden sollte. Ich habe dann schnell festgestellt: Übersetzen ist etwas, was ich kann und mir gleichzeitig großen Spaß macht. Wenn sich dieses Gefühl einstellt, dann weiß man, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat.
Was für ein großes Glück eine solche Chance zu bekommen. Du zählst mittlerweile zu den gefragtesten Übersetzern für schwedische Literatur – aber auch für norwegische, seitdem du den Weltbesteller Min Kamp von Karl Ove Knausgård übersetzt hast. Wie kam es dazu?
Bücher machen ist kollektives Arbeiten. Knausgårds damalige Agentin war und ist mit der deutschen Lektorin von Knausgård, Regina Kammerer, befreundet. Sie bat mich um ein Gutachten für eines seiner Bücher, das vor Min Kamp erschienen ist. Dass ich daraufhin die nächsten Jahre mit Knausgård verbringen würde, konnte keiner ahnen. In der Folge habe ich viele norwegische Titel angeboten bekommen. Ich habe schnell gemerkt, dass ich restriktiv vorgehen muss und mich eher wieder auf das Schwedische konzentriert. Ich musste mich am Ende regelrecht entscheiden. Früher habe ich grundsätzlich alles übersetzt, was mir angeboten wurde. Das würde ich auch jedem jungen Übersetzer oder Übersetzerinnen raten: So viel Erfahrung sammeln wie möglich.
Wie viele Bücher übersetzt du im Jahr?
Das hängt stark vom Umfang ab und davon, wie anspruchsvoll die Bücher sprachlich sind. Im Schnitt würde ich sagen, dass man vier bis fünf Bücher im Jahr schaffen kann, je nach Schwierigkeitsgrad.
Ich stelle mir den Beruf des Übersetzers als etwas extrem Persönliches vor.
Ja, auf jeden Fall – aber man muss sofort alles vergessen, wenn man sich begegnet. (lacht) Knausgård und ich haben noch nie über seine Bücher gesprochen. Das wäre uns beiden viel zu intim.
Immer wieder wird über die öffentliche Wertschätzung der Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern öffentlich diskutiert. Wie stehst du dazu?
Aus meiner Sicht sollten wir grundsätzlich genannt werden, in Rezensionen auf jeden Fall, aber auch auf dem Titel. Vielleicht ist das etwas paradox, denn gleichzeitig bin ich der Meinung, dass meine Arbeit genau dann besonders gut ist, wenn man beim Lesen vollständig vergisst, dass es eine Übersetzung ist. Es geht immer darum, den richtigen Ton zu treffen: es muss im Deutschen genauso passen wie im Schwedischen oder Norwegischen. Sprache, Ausdruck, Tonalität – alles. Gleichzeitig muss ich im Blick haben, wie der Markt funktioniert, muss mich orientieren, was literarisch gerade los und gefragt ist.
Du wirst von Verlagen oft um Gutachten gebeten, oder?
Ja genau. Das bedeutet einmal mehr, dass ich sehr viel lesen muss, vor allem auch deutschsprachige Literatur, englische Texte, französische… Ich muss die Qualität einordnen können.
Nun bist du, genau wie ich, Mitglied der Literaturszene Köln und gemeinsam setzen wir uns mit dem Verein für die Sichtbarkeit von Literatur und dem Literaturbetrieb in unserer Stadt ein. Im Rahmen der Kölner Literaturnacht, zu deren KuratorInnen du ebenfalls gehörst, haben wir großen Wert daraufgelegt, explizit Veranstaltungen mit Übersetzerinnen und Übersetzern zu machen. Wie empfindest du die Situation für deinen Beruf hier in Köln?
Ich würde mir schon wünschen, dass es auch auf lokaler Ebene mehr Würdigung der Arbeit von literarischen ÜbersetzerInnen gibt. Natürlich gibt es eine Reihe von Preisen und Stipendien, aber im Gegensatz zu anderen großen Städten in Deutschland gibt es in Köln keine Stipendien oder Preise für Kölner ÜbersetzerInnen wie etwa in Hamburg und München. Dabei geht es mir gar nicht so sehr um Geld, sondern darum, auch auf der Ebene zu zeigen, dass man Übersetzer als Bestandteil des literarischen Lebens nicht nur nachrangig wahrnimmt.
Ich danke dir für das Gespräch, lieber Paul.