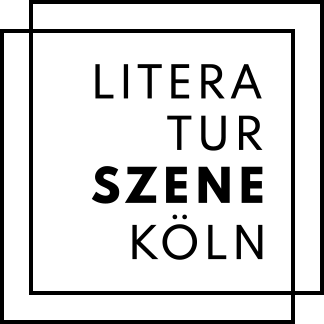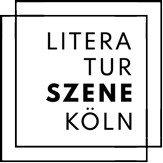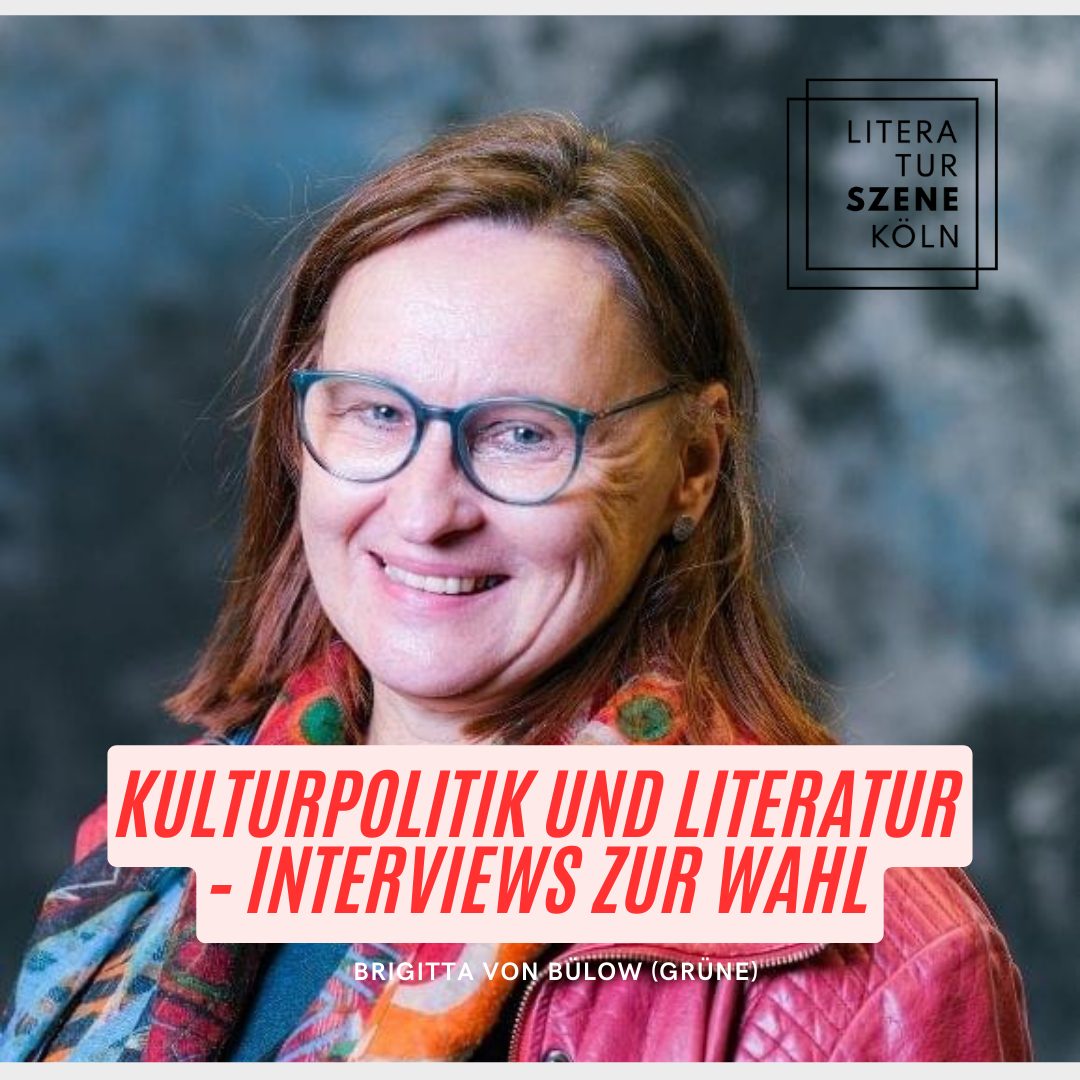Vom 5.-7. September 2025 findet zum siebten Mal das Europäische Literaturfestival Köln-Kalk, kurz: eLk, statt. Auf dem Ottmar-Pohl-Platz werden wieder Dichter:innen aus ganz Europa zusammen kommen, um vor Publikum zu lesen. In diesem Jahr lautet das Thema ‚Tiere‘. Wir haben mit Jonas Linnebank des Organisationsteams über die Anfänge des Festivals und die aktuelle Ausgabe gesprochen.
Ein europäisches Literaturfestival in Köln-Kalk. Wie ist die Idee entstanden und warum habt ihr euch gerade für den Schwerpunkt auf europäische Literatur entschieden?
Ursprünglich gab es 2019, in dem Jahr, als eLk ins Leben gerufen wurde, einen Austausch mit griechischen Dichter:innen, der von Adrian Kasnitz und einer griechischen Literaturzeitschrift sowie einem griechischen Verlag in Athen angestoßen wurde. Das war toll, weil die Flüge nach Athen und alles für uns bezahlt wurden. Dort entstand natürlich auch die Idee, die Menschen zurück nach Köln einzuladen, was sich aber aufgrund der deutschen Förderlandschaft als etwas schwieriger erwies. Es gab dann genau zu dem Zeitpunkt eine Ausschreibung der Bürgerstiftung „KalkGestalten“ zum Thema „Europa in Kalk“. Das war das ausschlaggebende Moment. Wir haben uns dann gesagt: Gut, dann laden wir eine der Dichter:innen ein. Danae Sioziou hatte glücklicherweise Zeit. Von dort aus haben wir weiter überlegt: Wen kennen wir noch? Und dann haben wir quasi ohne Förderung, relativ kurzfristig mehrere Leute eingeladen. Es wundert mich immer noch, dass die Autor:innen für so wenig Geld gekommen sind. Das Konzept hat sich im Anschluss verselbstständigt, weil es den Leuten und uns so viel Spaß gemacht hat. Und der Name europäisches Festival verpflichtet dann ja auch auf eine Art. Das ist nicht immer so einfach. Denn obwohl wir Europa als Idee gut finden, ist natürlich nicht immer so gut, was politisch in Europa passiert oder wofür es steht. Bis jetzt allerdings ist es uns immer ganz gut gelungen, anderen ihre Freiheit zu lassen und die Gemeinsamkeiten zu betonen. Genau das macht das eLk unter anderem auch aus!

©Fadi Elias
Ihr setzt ja immer auch bestimmte Themenschwerpunkte. Versucht ihr damit auch politische Akzente zu setzen?
Damit haben wir nach einigen Ausgaben angefangen, und zwar über die Auseinandersetzung mit der Frage, was eigentlich ‚europäisch‘ bedeutet. Wir haben uns mit politischer Lyrik und dem Thema Exil beschäftigt. Dieses Jahr ist es das Thema ‚Tiere‘. Die Themen sind immer, wie auch bei der Literaturzeitschrift KLiteratur, eher Inspiration und weniger strenge Dogmen. So geht es in diesem Jahr natürlich auch um das Miteinander zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Natur, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Uns ist aufgefallen, dass viele der Dichter:innen, auch wenn sie nicht explizit über Tiere schreiben, beispielsweise häufig Tiervergleiche nutzen oder sich an Fabeln anlehnen.
Kannst du etwas über das diesjährige Programm sagen?
Uns ist irgendwann aufgefallen, dass ja auch Deutschland irgendwie zu Europa gehört. (lacht) Seitdem laden wir auch immer Dichter:innen ein, die auf Deutsch schreiben, die sich dann eine Sprache ihrer Wahl aussuchen dürfen, in die sie übersetzt werden. Das hat angefangen mit Lütfiye Güzel, die sich ins Russische übertragen lassen wollte. Zunächst aus eine Art Scherz, denn sie dachte, wir finden keine Übersetzer:innen dafür und sie wollte es uns absichtlich schwer machen. In diesem Jahr ist Senthuran Varatharajah zu Gast und liest zum ersten Mal seine Gedichte vor einer breiten Öffentlichkeit. Die werden dann auf Deutsch und auf Tamil vorgelesen. Außerdem kommt in diesem Jahr Gisela Heffes, die auf Spanisch schreibt. Sie wird Gedichte über Auslöschungen lesen. Yevgenia Belorusets kommt aus der Ukraine und schreibt auf Russisch und Ukrainisch und ist nun ins Deutsche übersetzt worden. Ihr letzter Band heißt „Über das moderne Leben der Tiere“. Also da ist der Zusammenhang zum Festivalthema offensichtlich. Krišjānis Zeļģis aus Lettland war auch schon einmal hier mit seinem Gedicht „Wilde Tiere“. Und Kinga Tóth, die in Ungarn geboren ist, lebt mittlerweile aber schon länger in Deutschland und Österreich. Ondřej Macl aus Tschechien hat ein längeres Stück eigentlich über seine Großmutter geschrieben, in dem immer wieder Tiere auftauchen. Außerdem freuen wir uns, dass Danae Sioziou es auch zum diesjährigen eLk wieder geschafft hat.
Wie läuft die Organisation und die Kuratierung bei euch genau ab? Wie wählt ihr z.B. aus, wen ihr einladet?
Einmal gibt es persönliche Lieblinge, die wir einfach immer gerne einladen würden. Die behalten wir dann teilweise über Jahre im Hinterkopf. Dann ist das Thema natürlich sehr wichtig. In diesem Jahr wussten wir beispielsweise, dass wir irgendwas zu Natur und über den Zusammenhang zwischen Mensch und Natur machen wollen. Wir wollten aber es nicht direkt ‚Natur‘ nennen. ‚Tiere‘ ist da ein guter Aufhänger. Ursprünglich hatten wir da an Fabeln gedacht. So lernen wir teilweise auch Autor:innen über das Thema kennen, wie beispielsweise diesmal Yevgenia Belorusets, wo das Thema ja bereits im Buchtitel steht. In diesem Jahr war es uns zudem wichtig, noch einmal einige Alumni einzuladen, auch um das Festival bewusst nachhaltiger zu gestalten und eine Art Community aufzubauen, die längerfristig im Austausch steht.

©Fadi Elias
Warum findet das eLk gerade in Köln-Kalk statt? Hat der Standort auch Einfluss auf die Form, die das Festival annimmt?
Meine polemische Antwort ist immer: Warum denn nicht in Kalk?! (lacht) Um die Frage ernsthaft zu beantworten, gibt es zwei Gründe. Erstens sind wir vom Team alle hier verankert. Auch durch das Integrationshaus, das Kooperationspartner ist, oder die Kölner Literaturzeitschrift und den Kunst e.V., also unseren Träger. Das kommt einfach dadurch zustande, dass viele von uns selbst hier wohnen, was auch mit den bei unserer Gründung noch günstigen Mieten im Veedel zu tun hatte. Sehr wichtig ist zudem, dass gerade Mehrsprachigkeit, die für unser Festival ja so entscheidend ist, in Kalk ein bisschen mehr Normalität hat als in anderen Vierteln Kölns. Dadurch kommen die lustigsten Sachen zustande. Vor vier, fünf Jahren hatten wir eine international recht unbekannte serbische Dichterin hier. In Serbien selbst ist sie allerdings sehr wohl bekannt. Dass sie kommt, haben dann einige serbischsprachige Leute hier aus den hiesigen Deutschkursen spitzgekriegt und auf einmal hatte die hier einen Fanclub von gut fünfundzwanzig Menschen sitzen, die nach den Gedichten frenetisch gejubelt haben. Sowas kann man nicht voraussehen. Oft kommen Menschen aus dem Veedel, die sich einfach darüber freuen, endlich mal wieder Hochkultur in ihrer Muttersprache live erleben zu können. Gerade dieser Fokus auf die Mehrsprachigkeit hat sich als funktionierendes Konzept herausgestellt.
In jüngerer Zeit wird vielerorts auf Bundes- und Landesebene über die Kürzungen im Literatur- und Kulturbereich diskutiert. Bekommt ihr als Festival davon etwas zu spüren?
Wir fallen zum Glück ein bisschen aus der Reihe und sind gut aufgestellt. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht ausschließlich von der Kulturförderung abhängig sind, sondern auch auf Töpfe der Förderung von Interkulturalität zurückgreifen können. Das ist unser Glück. Viel schlimmer finde ich, um es mal so zu formulieren, die „Projektitis“. Also die Tatsache, dass man jedes Jahr neue Anträge stellen muss und somit oft nicht weiß, ob Projekte, obwohl sie erfolgreich liefen, im kommenden Jahr wieder stattfinden können. Dieses Bangen jedes Mal strengt an.
Vielen Dank für das Gespräch, Jonas!