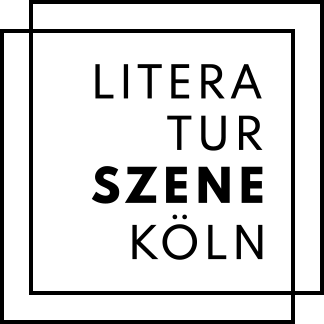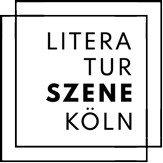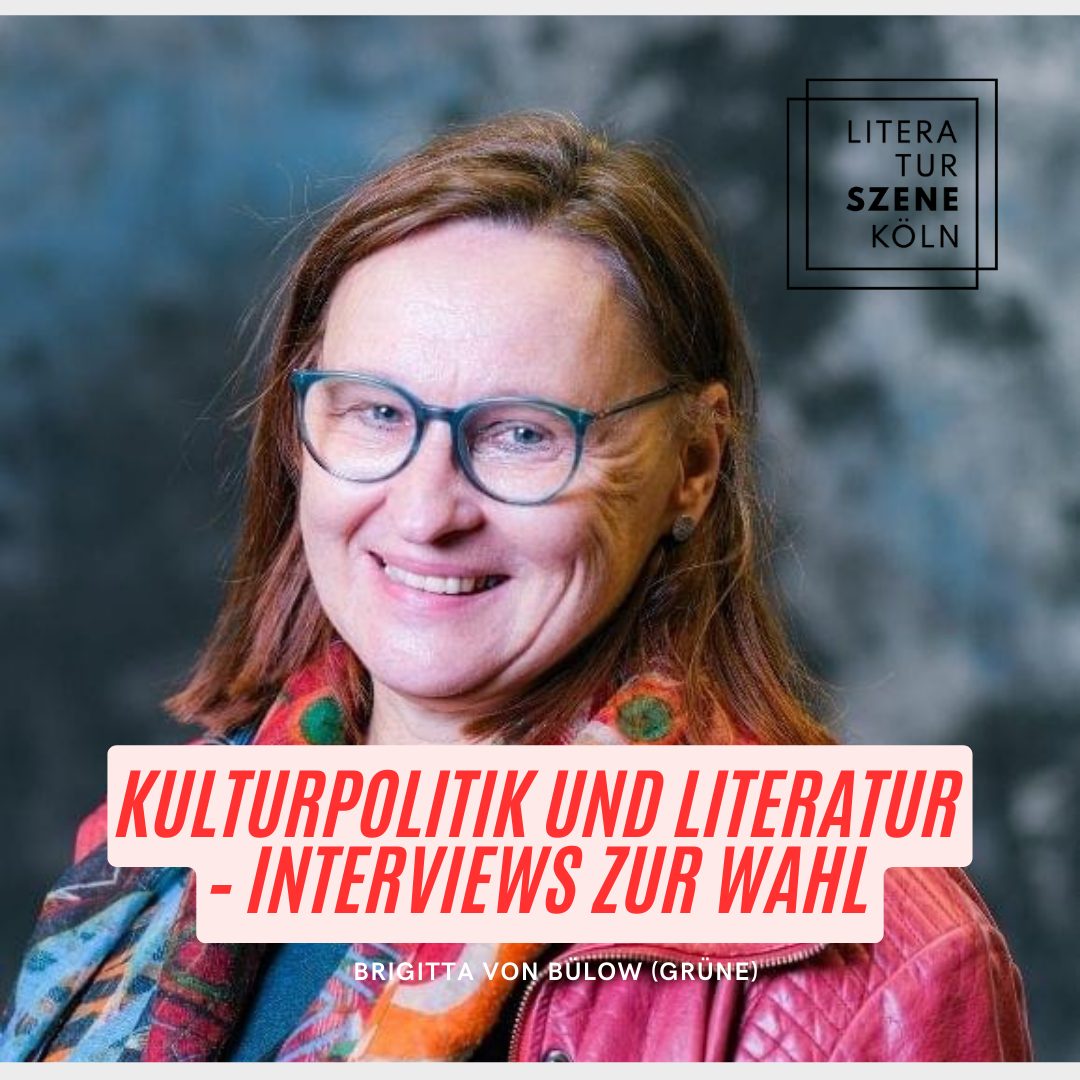Die Poetikdozentur TransLit an der Universität Köln folgt einem besonderen Auftrag: Sie will aufzeigen, wie Literatur sich aus ihrer wortgeprägten Form lösen und in andere mediale Formen ausweiten kann. Diese transmediale Herangehensweise öffnet Türen zwischen den Räumen verschiedener Künste.
Christof Hamann, Professor für Literaturwissenschaft und -didaktik, hat die TransLit vor zehn Jahren ins Leben gerufen und leitet sie seitdem. Er sprach mit uns über die aktuelle Dozentur und gab uns Einblick in die in dem Rahmen der TransLit anstehenden Veranstaltungen.
Die Dozentur für das Wintersemester 2025/2026 geht an die Schriftstellerin und Essayistin Tanja Maljartschuk. Sie legt in ihrem Werk den Fokus auf das Spannungsverhältnis zwischen Literatur und Politik. Inwiefern spannt sie mit dieser Untersuchung den Bogen zum Transliterarischen?
Die TransLit ist in diesem Wintersemester ausnahmsweise eine besondere. Das Institut für deutsche Sprache und Literatur I entschied sich angesichts des russischen Angriffskriegs für eine Veranstaltungsreihe, die verschiedenen ukrainischen Künstler*innen eine Plattform bieten sollte. Das Transliterarische rückt also in den Hintergrund. Im Mittelpunkt steht die ukrainisch-österreichische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk – sie hält am Mittwoch und Donnerstag in dieser Woche zwei Poetikvorlesungen an der Universität und liest Anfang Dezember im Literaturhaus aus ihren Werken. Das Thema der Poetikvorträge war Tanja Maljartschuk völlig freigestellt. Sie entschied sich dafür, über das spannungsreiche Verhältnis zwischen Literatur und Politik zu sprechen. Wer etwas mehr über diese Abende wissen möchte, dem empfehle ich, sich das Interview von Tanja Maljartschuk mit Uli Hufen im WDR anzuhören (https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr/westart/audio-autorin-im-gespraech—tanja-maljartschuk-ueber-literatur-als-poli-100.html)
Abgesehen davon bekommen außerdem das Visuelle und das Akustische eine eigene Bühne: Am 12. November wird es ein Konzert mit den ukrainischen Musikerinnen Anastasiia Haisiuk (Klavier) und Oksana Dondyk (Gesang) im Sancta Klara Keller geben. Und in der Woche darauf, am 19. November wird Ute Wegmann im Lew Kopelew Forum mit der ukrainischen Illustratorin Anna Sarvira sprechen.

Veranstaltungen im Rahmen der TransLit
Wie stark ist das Interesse an den Veranstaltungen, holen sie auch ein neues Publikum an die Universität?
Die Veranstaltungen finden in diesem Semester wie sonst auch zum Teil an der Universität statt. Und ja, ich wünsche mir, dass im Publikum auch viele Menschen sind, die nicht an der Universität zu Köln studieren. Das gelang in den vergangenen Jahren in aller Regel sehr gut. Aber wie sonst auch finden Veranstaltungen an Orten in Köln statt, die nicht zur Universität gehören. Ich habe den Sancta Klara Keller, das Lew Kopelew Forum und das Literaturhaus erwähnt. Ich hoffe, dass auch in den kommenden Wochen das Publikum bei sämtlichen Veranstaltungen ein sehr gemischtes sein wird.
Inwiefern sind die Studierenden in die Planung oder den Ablauf involviert?
Da die Planung und Organisation der TransLit eine lange Vorlaufzeit in Anspruch nimmt, die Studierenden das Modul, in dem die Dozentur verankert ist, aber in nur einem Semester studieren, ist es nicht möglich, die Studierenden in die Planung einzubeziehen. Im Semester, in dem die TransLit stattfindet, besuchen sie aber alle vorgesehenen Abendveranstaltungen und belegen darüber hinaus zwei Seminare, die sich auf die TransLit beziehen: Zum einen das Begleitseminar, in dem Texte der/des Poetikdozent*in gelesen, besprochen und diskutiert werden (und an das auch eine Schreibwerkstatt angebunden ist), zum anderen einen Kurs, der sich mit Grundlagen der Literaturvermittlung beschäftigt. Dieser Grundlagenkurs thematisiert zentrale Aspekte der Organisation und Durchführung einer Poetikdozentur (bzw. der Organisation/Durchführung von öffentlichen Literatur-Events) und leitet die Studierenden zu einem beobachtenden Besuch der TransLit-Abende an. Beide Kurse zusammen sind die Basis für eine letztlich praxeologisch fundierte Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Möglichkeiten, die mit der Veranstaltung/Durchführung der TransLit verbunden sind. Es geht dabei vorrangig um die Frage, wie gut das Anliegen der Vermittlung des konkreten Gegenstands funktioniert hat, und zwar in Hinblick auf alle Akteur*innen, also die/den Dozent*in, die Moderation, das Publikum.
Wir finden es natürlich schade, dass wir die Studierenden nicht von Beginn an mit der Organisation der TransLit betrauen und sie etwa auch an der Auswahl der/des Dozent*in beteiligen können, aber dies lässt sich im Rahmen eines modularisierten Studiengangs eben leider nicht umsetzen. Da die Seminare und die TransLit-Abende alle im gleichen Semester studiert werden, ist der praxeologische Ansatz der Beschäftigung mit der Dozentur unserer Meinung nach aber zielführend.
Gibt es in der Literatur generell den Bedarf, Grenzen aufzuheben?
Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Als ich mit einem Kollegen vor zehn Jahren die erste TransLit plante, gingen wir von der scheinbar banalen Tatsache aus, dass jede Literatur medial verfasst ist. Medial verfasst heißt, dass jede literarische Kommunikation auch von ihrer medialen Vermittlung abhängt. Je nachdem, über welches Medium ein Roman, ein Gedicht oder ein Drama rezipiert wird, verändert sich auch deren Bedeutung. Eine saubere Trennung von Bot*in und Botschaft erweist sich somit als unmöglich. Damit stellt sich zugleich die Frage nach den Gewinnen und Verlusten, die ein Medienwechsel mit sich bringt, aber auch die nach den kreativen Möglichkeiten, die ein solcher eröffnet.
Anders also als die inzwischen landesweit üblichen universitären Poetikveranstaltungen, bei denen Gegenwartsautor*innen ihre poetologischen Überlegungen in Vorlesungsreihen präsentieren, widmet sich das vom Institut für deutsche Sprache und Literatur I der Universität zu Köln organisierte Projekt unter dem Stichwort ›Literatur im medialen Wandel‹ somit einem Spezifikum des literarischen Lebens. Die Professur dreht sich primär um transliterarische Verfahren. Üblicherweise bezeichnet der Begriff ›Translit‹ die Übersetzung kyrillischer Lettern in das lateinische Alphabet, d. h. es geht um Fragen der Um- bzw. Recodierung. Zur Diskussion steht, wie alphabetisch formierte Kunst – eben Literatur – in ein anderes spezifisch codiertes Medium, sei dieses nun visuell oder akustisch, übersetzt wird.
Ziel der Professur ist normalerweise, im persönlichen Austausch mit den eingeladenen Autor*innen im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungstypen die Besonderheiten und vielfältigen Prinzipien medialer Adaptation von literarischen Texten kennenzulernen. Aber, wie gesagt, in diesem Semester ist alles etwas anders.
Vielen Dank für das Interview!